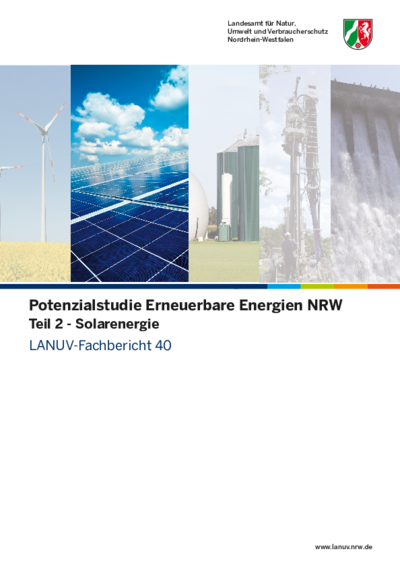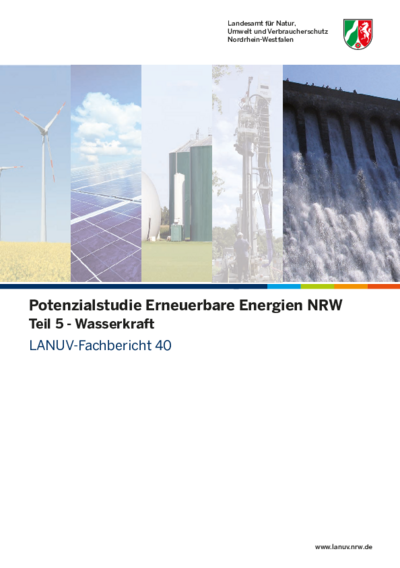Potenzialstudie Erneuerbare Energien NRW
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat sich zum Ziel gesetzt, die Erneuerbaren Energien in NRW stark auszubauen. Dazu hat sie das Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht in dem festgeschrieben ist, den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen drastisch zu reduzieren. Bis zum Jahr 2020 sollen 25 % der Treibhausgasemissionen gegenüber 1990, bis 2050 sogar über 80 % eingespart werden. Ein Eckpunkt des Klimaschutzgesetzes ist der Ausbau der Erneuerbaren Energien. In diesem Rahmen hat das MKULNV das LANUV mit der Durchführung der Potenzialstudie Erneuerbare Energien NRW beauftragt. Durch fundierte Analysen für die Energieformen Solarenergie, Windenergie, Bioenergie, Geothermie und Wasserkraft sollen Potenziale zu ihrem weiteren Ausbau ermittelt werden. Der Fokus liegt insbesondere auf der Darstellung regionaler Potenziale, möglichst auf der Gemeindeebene. Die Ergebnisse werden hier im Fachinformationssystem Energieatlas NRW veröffentlicht. Sie sollen als Grundlage für die unterschiedlichen Planungsebenen, wie z.B. Kommunen, Kreise, Bezirksregierungen und Genehmigungsbehörden, dienen.
Potenzialstudie Geothermie Nordrhein-Westfalen
Die Potenzialstudie Geothermie steht seit April 2015 als "LANUV-Fachbericht 40" als Download zur Verfügung. Im Rahmen der Potenzialstudie Geothermie wurden die wärmetechnischen Potenziale der oberflächennahen Geothermie berechnet. Die Studie beschränkt sich hierbei auf die Nutzung durch Erdwärmesonden und einer maximalen Erschließungstiefe von 100 m. Dabei wurden zunächst die Freiflächenanteile jedes Grundstücks in NRW mit Hilfe eines geographischen Informationssystems ermittelt sowie die technisch nutzbaren geothermischen Potenziale unter Annahme verschiedener Randbedingungen berechnet. Anschließend wurde durch Bezug auf den Wärmebedarf der Gebäude das technisch nutzbare geothermische Potenzial grundstücksscharf ausgewiesen. Auf der einen Seite ergibt sich so die geothermische Ergiebigkeit auf Grundlage des Flächendargebots, der Untergrundeigenschaften, des klimatischen Einflusses und etwaiger Restriktionsbestimmungen. Auf der anderen Seite wird das Gebäude entsprechend seiner Größe und Nutzungsart als Wärmesenke definiert. Unter den getroffenen Annahmen ergibt sich ein Wärmebedarf von 271,1 TWh/a für alle Gebäude in NRW. Dem gegenüber steht ein technisch nutzbares geothermisches Potenzial von 153,7 TWh/a im Szenario A (mit Wasserschutzgebiet III, IIIa, IIIb und IIIc) und 141,3 TWh/a im Szenario B (ohne Wasserschutzgebiet III, IIIa, IIIb und IIIc). Somit ergibt sich für ganz NRW ein prozentualer Deckungsanteil von 56,7 % im Szenario A und 52,1 % im Szenario B. Dies bedeutet, dass über die Hälfte des Wärmebedarfs der Gebäude über die oberflächennahe Geothermie mittels Erdwärmesonden gedeckt werden kann.
Verwandte Publikationen
Externer Inhalt
Schutz Ihrer Daten
An dieser Stelle haben wir den Inhalt eines Drittanbieters, bspw. YouTube, X, Instagram etc., eingebunden. Bitte bestätigen Sie über den Button, dass Sie damit einverstanden sind, diese Inhalte zu sehen!
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutz.